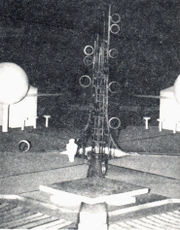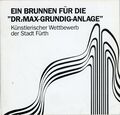Paradiesbrunnen
- Gebäude
- Paradiesbrunnen
- Straße / Hausnr.
- Dr.-Max-Grundig-Anlage
- Objekt
- Paradiesbrunnen
- Baujahr
- 1995
- Bauherr
- Stadt Fürth
- Architekt
- Barbara und Gernot Rumpf
- Geokoordinate
- 49° 28' 17.93" N, 10° 59' 33.02" E
- Gebäude besteht
- Ja
- Denkmalstatus besteht
- Nein
Der Paradiesbrunnen auf der Dr.-Max-Grundig-Anlage ist eine Brunnenanlage des Bildhauer-Ehepaars Barbara und Gernot Rumpf. Gestiftet wurde der Brunnen von Max Grundig, der eigens hierfür 100.000 DM zur Verfügung stellte. Die Einweihung des Brunnens fand am 17. September 1995 statt.
Für die Errichtung des Brunnens musste der rechteckige, leicht abschüssige, Platz der ehemals „Kleinen Freiheit“ aufgeschüttet werden, wodurch an der kurzen Seite Richtung Fürther Wochenmarkt Treppenstufen entstanden. Auf der gegenüberliegenden Seite wurden Steinbänke als Sitzgelegenheiten gesetzt und die Längsseiten mit Reihen von Platanenbäumen gesäumt und je vier weiteren Steinbänken „begrenzt“.
Die Brunnenanlage aus dem Jahr 1995 ist gestaltet mit zwei getrennten, flachen Becken, die von Tieren wie Schlange, je zwei kleinen Mäusen und Schnecken, Ammoniten, einem Taubenpaar, mystischen Figuren wie ein kleiner Drache und dem mächtigen Einhorn sowie den großen Plastiken Adam und Eva „bevölkert“ sind. Dazu die aus dreißig Düsen spritzenden und sprudelnden Wasserspiele, aus großen Schneckenhäusern und weiteren Quellen, die elektronisch, in nicht konstanten Intervallen, gesteuert werden.
Eine Esche als Lebensbaum in der Mitte und der Regenbogen, der das Innere des Brunnens mit der umgebenden Fläche verbindet, runden das Kunstwerk ab.
Der Paradiesbrunnen wurde bewusst offen gestaltet – zum Hineingehen, Planschen, Klettern und Spielen. Der kleine Drache ist einer der Trinkbrunnen in Fürth.
Sämtliche Figuren wurden aus Bronze gegossen, mit der hochwertigsten Legierung von 90 Prozent Kupfer und 10 Prozent Zinn, einem sehr widerstandsfähigen Material. Einzelne Teile sind bemalt. Die Wasserbecken, Strudelspiralen und Sitzbänke wurden aus Granit gearbeitet.
Entstehung
Max Grundig hatte noch zu Lebzeiten der Stadt Fürth eine Spende über 1 Mio. DM gemacht, wovon für den Bau eines Brunnens ca. 100.000 DM zur Verfügung gestellt wurden. 1990 - ein Jahr nach Grundigs Tod - wurde zur Klärung der Gestaltungsfrage ein überregionaler Künstlerwettbewerb ausgeschrieben. Aufgabenstellung in der Ausschreibung: Den Bezug evtl. zur Ludwigseisenbahn herstellen - ist aber nicht zwingend notwendig - und eine Brunnenlösung finden, die den Betrachter mit einbezieht; d. h. der Betrachter ist nicht nur außenstehender Passant, sondern kann mit dem Brunnen interagieren. Es sollte ein Erlebnisraum bzw. ein Kommunikationsort entstehen.
An dem Wettbewerb konnten alle Bildenden Künstler teilnehmen, die zum Zeitpunkt der Auslobung mindestens drei Monate ihren Hauptwohnsitz in Fürth hatten. Daneben waren drei Preisträger eines vorab an der Akademie der Künste Nürnberg durchgeführten Wettbewerbes (für Studenten und Absolventen) teilnahmeberechtigt. Namentlich wurden zudem noch eingeladen Prof. Gernot Rumpf (Neustadt/Weinstraße), Hannelore Köhler (Düsseldorf), Helmut Otto Schön (Pfaffenhofen), Joachim Schmettau (Berlin) und Heinz Heiber (Nürnberg).
Unter den zahlreichen Einsendungen der Entwürfe sollte eine neunköpfige Jury den besten Entwurf aussuchen. Unter den Bewerbern waren namhafte nationale und lokale Künstler, so dass der Jury die Auswahl nicht leicht fiel. In Jury saßen u. a. der Oberbürgermeister Uwe Lichtenberg, der Vorsitzende des Baukunstbeirates Georg Stolz und die damalige Stadtheimatpflegerin Barbara Ohm.
Den 1. Preis erhielt mit 6:3 Stimmen das "Wasserhaus" vom lokalen Künstler Michael Munding aus Stein, ein 15 Meter hoher Brunnen mit jeweils 12 Metern Seitenlänge, der eher den Charakter eines Turmes aufwies. Der 2. Preis ging einstimmig an die Künstler Hans Vogel und Hannes Arnold, jedoch mit dem Hinweis, dass der vorgelegte Entwurf noch stark überarbeitet werden müsste. Der Brunnen stellte ein Art Gleis-Installation - vermutlich in Anlehnung an die Ludwigseisenbahn - dar. Der 3. Preis ging mit 7:2 Stimmen an den Paffenhofener Helmut Otto für seinen Entwurf einer Wasserpyramide. Der Entwurf von Heinz Heiber (Nürnberg) erhielt einstimmig das Votum zum "Ankauf". Weitere Entwürfe kamen u. a. vom lokal bekannten Steinhauer Heinz Siebenkäss und dem Braunschweiger Künstler Jürgen Weber, der z. B. das Ehekarussell am Weißen Turm in Nürnberg schuf.

Der 1. Preis galt dann jedoch als nicht realisierbar. Das Wasserhaus wurde von der Presse (Abendzeitung) als "undurchführbarer netter Gag" bezeichnet, die Idee eines Cafes im Inneren des Brunnens scheiterte am mangelnden Platz. Auch die Auswahl des Materials - Beton - wurde massiv kritisiert, so dass sich die Stadt zunächst für den 2. Preis entschied - sehr zum Missfallen des Preisträgers. Auf seine Frage, wozu er den 1. Preis bekommen hat, wenn dann der 2. Preis genommen wird, erwiderte der damalige Baureferent Dieter Matuschowitz: "... es handelt sich eben um einen Ideenwettbewerb, nicht um einen Realisierungswettbewerb."
Doch auch der 2. Preis wurde kritisch gesehen. Zwar war die Realisierung möglich, aber die Mehrheit der Stadträte empfand den Brunnen als "wesentlich verbesserungswürdig". Der Brunnen sah nach oben strebende Schienenstränge mit seitlichen Ringen/Rädern vor. Schnell wurden auch Bedenken laut, dass der Brunnen von Passanten und Kindern als Kletterturm genutzt werden könnte - manche sprachen auch ironisch vom "vielleicht zweitschönsten Blitzableiter auf dem europäischen Kontinent". Der Schönste sei aber unstrittig weiterhin der Eiffelturm in Paris, so die damalige Stadtillustrierte Fürther Freiheit in der Berichterstattung.[1]
Der Bauausschuss kam nach langer Diskussion zu der Erkenntnis, dass der Wettbewerb ein Flop war, und so entschied sich der Stadtrat in der Folge erneut zu einem Wettbewerb. Mit dem Hinweis, dass auch der Centaurenbrunnen erst nach 12 Jahren Entscheidungszeit entstand, wurde 1993 erneut ein Wettbewerb ausgeschrieben. Dieses Mal machten die beiden Künstler und Ehepartner Barbara und Gernot Rumpf aus Neustadt an der Weinstraße das Rennen. Den Zuschlag erhielt der Vorschlag u. a. deshalb, weil sie mit einigen Brunnen auch schon internationale Erfolge feiern konnten. Die meist biblischen Brunnenmotive sind in vielen deutschen Städten zu sehen, besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang der Löwenbrunnen in Jerusalem (Israel), der ein Geschenk der Bundesrepublik Deutschland an Jerusalem war.[2]
Die Einweihung musste mehrfach verschoben werden, da die künstlerischen Elemente des Brunnens nicht rechtzeitig fertig wurden. Gegenüber der Presse gab der damalige Baureferent Joachim Krauße an, dass die erneute Verschiebung des ursprünglich für den 25. Juli 1995 geplante Einweihung ein „Trauerspiel“ sei. Die Einweihung konnte schließlich am Tag der offenen Tür am 17. September 1995 stattfinden.[3]
Darstellung, Motive
- Die Esche und der Standort „in der Mitte“: In Anlehnung an das Bild des Gartens Eden, wo „der Baum des Lebens“ der Mitte steht. Der Baum als Symbol des Lebenslaufes mit Entstehen, Grünen im Frühling, Blühen und Wachsen im Sommer, Früchte im Herbst und „Vergehen“, In-sich-Zurückziehen im Winter. „Yggdrasil“, eine Esche, verkörpert in der nordgermanischen Mythologie als Weltenbaum den gesamten Kosmos.
- Zwei ineinander verschlungene, mit Wasser gefüllte, Spiralen: Sie umgeben und umfließen den Lebensbaum und stehen für Leben, Veränderung und Weiterentwicklung.
- Schlange: Ein zweifacher Strahl spritzt unregelmäßig aus den Nasenlöchern. Sie hat mit dem Versprechen zur „Erkenntnis“ zum Sündenfall verführt.
- Apfel: Auf einer der Steinbänke befindet sich ein klein und groß „angebissener“ Apfel, als Symbol der Verführung.
- Ammoniten, Drache, Schnecken: Teils vorzeitliche Tiere, die die Fülle der Schöpfung darstellen sollen.
- Einhorn: Ein Fabeltier in vielen Kulturen, ein kraftvolles Tier, das als Glücksbringer galt, jedoch nicht gebändigt werden konnte. Nur beim Anblick einer Jungfrau soll es sanft geworden sein. Daher wurde es im christlichen Kontext ein Sinnbild der Reinheit.
- Zwei kleine Mäuse: Sie verkörpern das Künstlerpaar.
- Adam: Vermittelt mit Helm, Schild und Stiefeln einen Eindruck von Angriff, aber auch für die Notwendigkeit von Abwehr und Schutz.
- Lilith und Eva: Zweigeteilt und doch Eins, als Symbol der natürlichen Gleichheit von Mann und Frau, im Selbstverständnis von Lilith. Lilith ist in der jüdischen Legende die erste Frau Adams, die sich ihm nicht unterordnen wollte, weil „wir sind beide gleich, weil wir beide aus der Erde stammen“. Sie flog davon. Eva dagegen, steht mit beiden Füßen auf dem Boden der Realität. Mit der Doppelfigur wird das aktuelle Thema der Gleichberechtigung als uraltes Menschheitsproblem dargestellt.
- Regenbogen: Zeichen der Verbindung, Versöhnung und Zuversicht. Paradies ist nicht nur etwas, das die Menschen verloren haben, sondern das auch als Hoffnung existiert.[4]
Siehe auch
- Fürther Freiheit
- Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage
- Der Fürther Paradiesbrunnen
- Wasserhaus
- Hirschgarten
- Weltbaum
Literatur
- Baureferat der Stadt Fürth (Hrsg.): Ein Brunnen für die "Dr.-Max-Grundig-Anlage" - Künstlerischer Wettbewerb der Stadt Fürth, o. J. (vermutlich 1990 oder 1991)
- Barbara Ohm: Der Fürther Paradiesbrunnen, Geschichtsverein Fürth e. V., Fürth, 1996
Einzelnachweise
- ↑ Andy Reum: "Wir entscheiden heute nix!". In: Stadtillustrierte Fürther Freiheit, Nr. 52 Ausgabe März/April 1991, S. 8 ff.
- ↑ Barbara Ohm: Der Fürther Paradiesbrunnen. Geschichtsverein Fürth, Fürth, 1996, S. 6 ff.
- ↑ ru: Brunnen bleibt vorerst trocken. In: Fürther Nachrichten vom 7. Juli 1996, S. 29 (Druckausgabe)
- ↑ Barbara Ohm: Durch Fürth geführt, Band 1 - Die Stadt zwischen den Flüssen. VKA Verlag Fürth, 1999, 2005, 1991, S. 94-95.
Bilder
Figuren Details, Lilith und Eva „eingerahmt“ vom Regenbogen, am Paradiesbrunnen vom Bildhauerehepaar Barbara und Gernot Rumpf, März 2025
Figuren Details, Einhorn, am Paradiesbrunnen, im Hintergrund Gebäude Königswarterstraße 20 und 18, März 2025
Die Kleine Freiheit mit Paradiesbrunnen gespendet von Max Grundig im April 2003
Platanen werden gepflanzt, die Fürther Freiheit wird umgestaltet mit einer 100.000 DM Spende von Max Grundig. Im Hintergrund die Straßenbahnhaltestelle am Hirschgarten, die heutige Dr.-Max-Grundig-Anlage mit dem Paradiesbrunnen. Hinten Eckgebäude Gustav-Schickedanz-Straße 5, daneben Häuserzeile Rudolf-Breitscheid-Straße 17 bis 25 am 2.4.1979